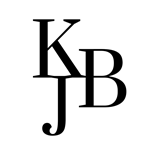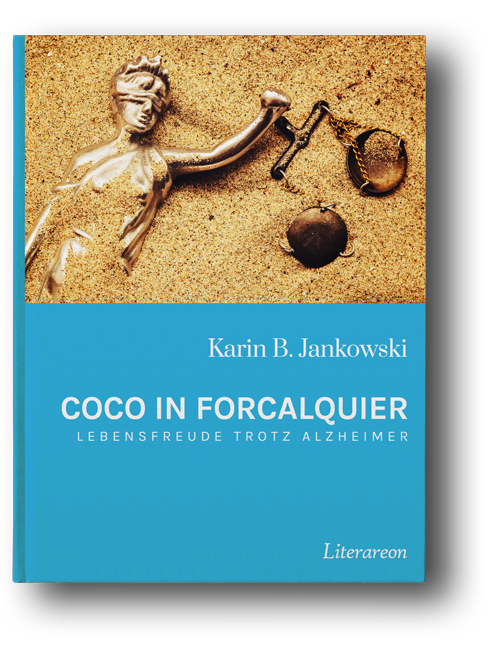ÜBERSICHT
Lesen Sie bequem alle Leseproben auf einer Seite
IN SCHRIFT...
Die Meisten von uns LESEN ihre Bücher immer noch. Wenn auch Sie das klassische Lese-Erlebnis einem Hörspiel vorziehen, dann können Sie hier genüsslich anlesen.
STÖBERN SIE
Don’t judge a book by its cover!
Wenn auch Sie ein Buch nicht nach seinem Umschlag beurteilen wollen, dann lesen Sie es doch einfach an, bevor Sie kaufen!
...UND WORT!
Für Diejenigen unter Ihnen, die lieber hören anstatt selbst zu lesen, gibt es Hörproben von ausgewählten Werken zum Probe-Hören.
Sie haben die Wahl!
- Roman
Vertrau mir!
Das letzte Geheimnis - TEIL 2
Und last but not least möchte ich den zweiten Teil von „Das letzte Geheimnis“ verraten. Viele Leser haben mich gefragt, wie es weitergeht … (die 3 Punkte müssen bleiben; streichen: und ich denke, ich stell euch einfach mal Steff vor in der Leseprobe. Gleich anklicken!
Ein Page-Turner voller Überraschungen und tiefen Einblicken in die menschliche Seele. Ein Verwirrspiel der Gefühle. Spannung bis zur letzten Seite ist garantiert.
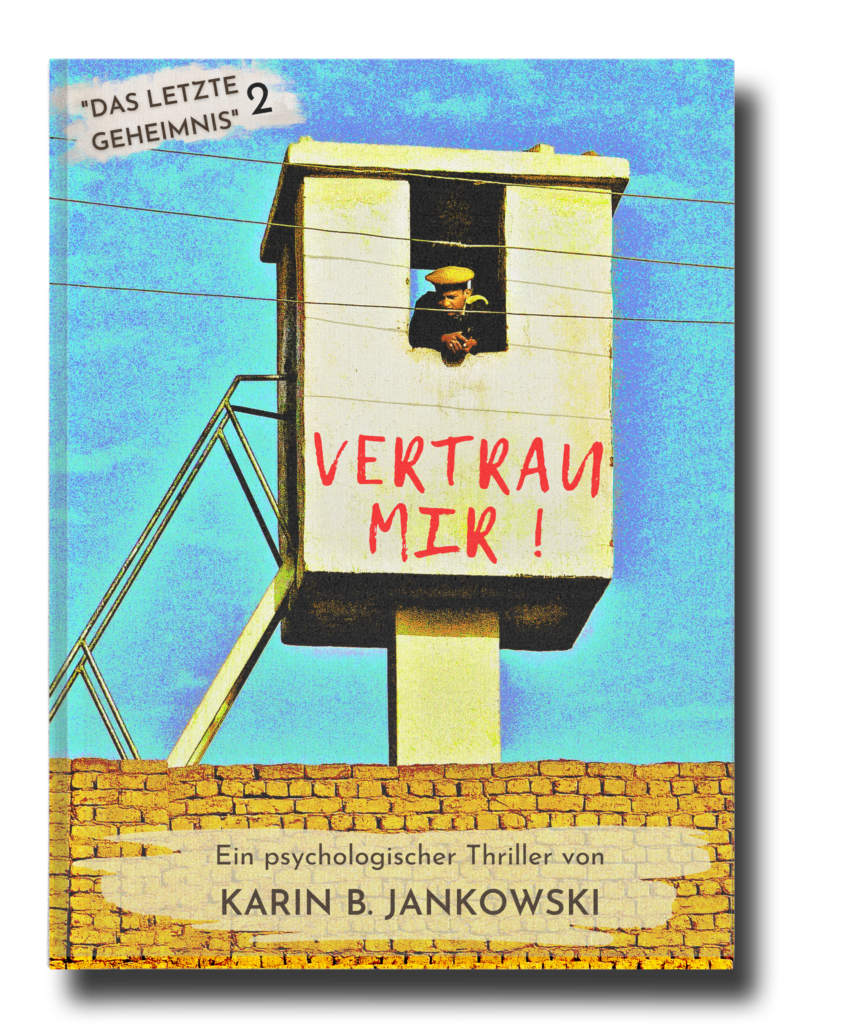

- Roman
Der lange Weg zu Dir, Chéri
Episoden-Roman
Jeder Mensch begegnet in seinem Leben vielen anderen Menschen. Männern und Frauen. Ich habe mich in meinem Büchlein auf „Männer“ spezialisiert. Und daraus entstanden ist ein sauer-süsses, lustig und gleichzeitig nachdenklich stimmendes Kaleidoskop mitten aus dem Leben.
Ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen – zwischendurch mitgefühlt und auch schallend gelacht!
- Sammelband
Moords-Geschichten - Band 1
Kleine Geschichten rund um Leben & Tod
Für jeden Tag im Monat eine neue Geschichte. Nicht nur zum Fürchten – aber auch. Nicht nur zum Schmunzeln – aber auch. Vor allem nicht zum Nachahmen, auf gar keinen Fall!!! Aufgrund des grossen Erfolges von Band 1 hat sich die Autorin 13 neue Kurzgeschichten einfallen lassen, die genauso böse, lustig und sexy sind wie die ersten – vielleicht sogar noch mehr!
Die kleinen Geschichten rund um Leben und Tod regen zum Nachdenken an und sind menschlich, tief und einfühlsam. Der schwarze Humor ist nicht der von Roald Dahl, sondern der von Karin B. Jankowski. Eine gelungene Mischung aus deutschem, französischem und belgisch-luxemburgischen Flair. Regional und kosmopolitisch zugleich.

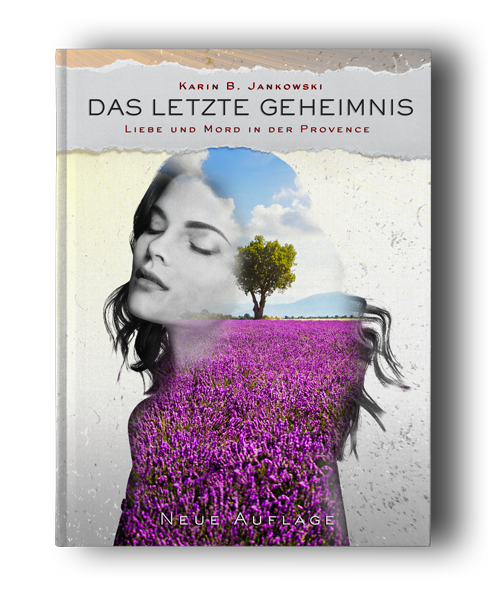
- roman
Das letzte Geheimnis
Liebe und Mord in der Provence
Ein spannender Roman mit tiefen Einblicken in die menschliche Seele und eine Welt, vor der viele Menschen Angst haben – die in Wirklichkeit aber keine andere ist als die, in der wir leben. Erst wenn wir das erkennen, können wir sie ändern
„Ich lese viel. Aber das ist ein ganz anderes Buch. Man spürt, dass hier nichts erfunden wurde. Was für ein Leseerlebnis.“
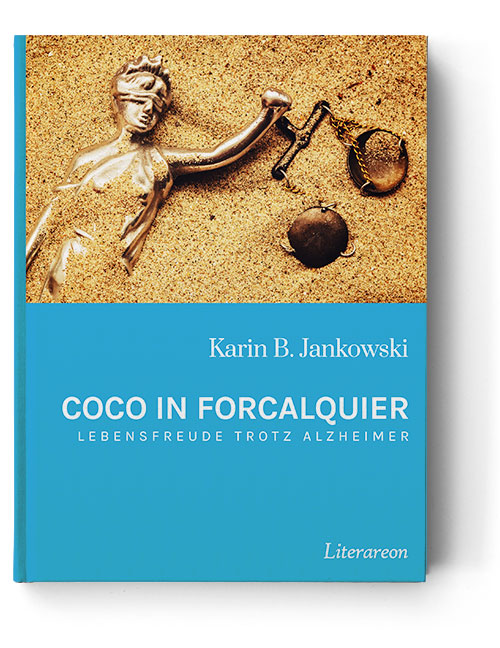
- Roman
Coco in Forcalquier
Lebensfreude trotz Alzheimer
Margaret, die zusammen mit ihrer Katze Coco auf dem Anwesen der Autorin Urlaub macht und deren Mutter und Grossmutter bereits an Alzheimer litten, erfährt am eigenen Leib, was diese Krankheit bedeutet.
Karin B. Jankowski spricht in ihrem einfühlsamen Erfahrungsbericht über die Höhen und Tiefen, Ängste und Hoffnungen von Alzheimerpatienten und deren Angehörigen.
„Erfrischend ehrlich und sehr alltagsnah erfährt der Leser nützliche und manchmal auch amüsante Tipps zum Umgang mit Alzheimer.“
- Self-help
Die Reise ins Innerste & zurück
Wege aus der Depression
Ohne Gepäck oder Proviant, ohne Landkarte und Empfehlungen geriet Karin Bohr-Jankowski auf eine Reise in den Abgrund ihrer Seele. Depressionen hielten sie jahrelang gefangen. Ihr fehlte zeitweise die Kraft zum Leben, zum rationalen und rationellen Arbeiten, zum Alltagskampf.
„Ich kenne mich aus mit Depressionen. […] Ich habe das Büchlein, das nicht grösser ist als mein Lieblingsbuch „Der Kleine Prinz“, mehr als einmal gelesen und mich gefreut, dass ich nicht alleine bin mit meiner Krankheit. Ich habe sogar wieder eine Therapie angefangen. Vielen Dank, Karin. Schreib bitte weiter.“

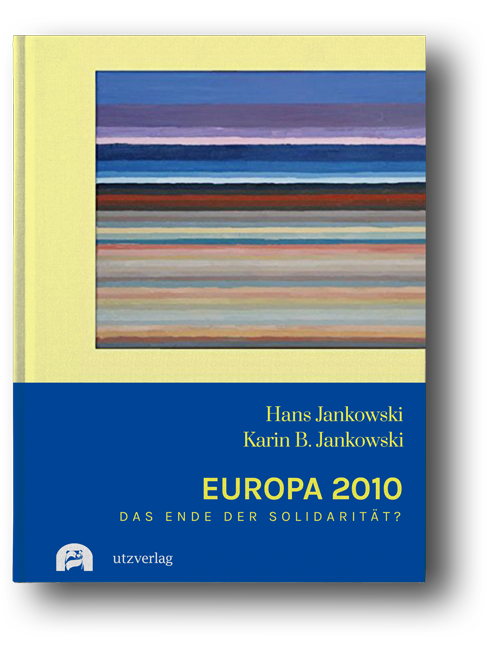
- Sachbuch
Europa 2010
Das Ende der Solidarität?
Bedeutet Europa 2010 das Ende der Solidarität, fragten wir uns in den letzten Monaten. Warum haben wir Sie nicht gefragt? Ganz einfach: Wir haben Sie noch nicht erreicht.
Mit diesem Büchlein bitten wir Sie, sich selbst Ihre Meinung zu bilden. Nehmen Sie sich die Zeit zu lesen, was wir Ihnen gerne sagen würden.
„Dieses Büchlein gibt Hinweise, wie das Vertrauen des Bürgers in Europa wiedergewonnen werden kann.“


- Sammelband
Moords-Geschichten - Band 2
Kleine Geschichten rund um Leben & Tod
Und schon wieder hat die Autorin zugeschlagen: Wie schon im ersten Band ihrer Mooords-Geschichten unterhält sie uns mit spritzig-gruseligen Kurzgeschichten, in denen man nie weiss, wer einem sympathischer ist – die Täter oder ihre Opfer. Zum Lesen, aber auch zum Vorlesen, unbedingt!